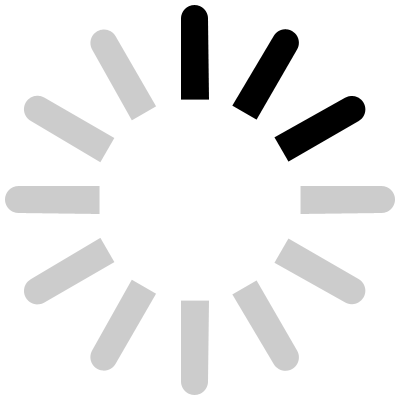03400 Evidenzbasierte Instandhaltung von Medizinprodukten
|
Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass die von den Herstellern empfohlenen Instandhaltungsmaßnahmen oftmals Maximalforderungen und in der klinischen Praxis nicht angemessen umsetzbar sind. Die evidenzbasierte Instandhaltung von Medizinprodukten ist eine Instandhaltungsstrategie, die darauf abzielt, solche Instandhaltungsmaßnahmen anzuwenden, die – auf der Basis realer Nutzungsdaten – wirksam und angemessen sind, um die Sicherheit der Medizinprodukte zu gewährleisten und die vom Hersteller definierten Leistungsmerkmale zu erhalten. Das ist ein innovativer Ansatz, der darauf abzielt, die Effizienz und Sicherheit in der medizinischen Versorgung zu verbessern.
Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz gewinnt dieser Ansatz zunehmend an Bedeutung, da er auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und realen Nutzungsdaten basiert, um die Wartung und Pflege von medizinischen Geräten zu optimieren. von: |
Schnelleinstieg ins Thema
Abschnitt | Um was geht es? |
|---|---|
Ausgangslage (s. Abschn. 1) | Definition und aktuelle Situation von (evidenzbasierter) Instandhaltung |
Neuer risikobasierter Ansatz (s. Abschn. 2) | Vorteile der evidenzbasierten Instandhaltung in Bezug auf Kosten, Risikomanagement und Ressourcenschonung |
Richtlinie VDI 5707 Blatt 1:2023-02 (s. Abschn. 3) | Wie die VDI-Richtline bei der Instandhaltung hilft und was noch fehlt |
Vigilanzsystem Medizinprodukte (s. Abschn. 4) | Hersteller-Vigilanzsystem als Datenquelle nutzen |
Fallbeispiel: Wartung der Deckenversorgungseinheiten (s. Abschn. 5) | Ein Beispiel aus der Praxis, wie eine evidenzbasierte Instandhaltung angewendet werden kann |
Tools für eine Schwachstellenanalyse (s. Abschn. 6) | Informationen über die Anwendung von Lean Management, FMEA, EBM, PNM-Tools sowie Dashboarding |
Service-Management-Plattformen (s. Abschn. 7) | Vorstellung von verschiedenen Plattformen und deren Möglichkeiten |
Datengewinnung Kennzahlen (s. Abschn. 8) | Eine Einführung in die Ermittlung und die Vorteile von Kennzahlen |
Benchmarking und Benchlearning (s. Abschn. 9) | Wie man kurz- und langfristig Fähigkeits- und Wissenslücken zur Instandhaltung schließt |
1 Ausgangslage
Evidenzbasierte Instandhaltung bedeutet, dass die Wartung und Pflege von Medizinprodukten nicht nur auf den Empfehlungen der Hersteller basiert, sondern auch auf empirischen Daten und wissenschaftlichen Studien sowie den Erkenntnissen über deren reale Nutzungsbedingungen. Dieser Ansatz ermöglicht es, Wartungsintervalle und -methoden zu entwickeln, die besser auf die tatsächlichen Nutzungsbedingungen und -anforderungen abgestimmt sind.
Vorteile der evidenzbasierten Instandhaltung
| • | Effizienzsteigerung: Durch die Betrachtung realer Nutzungsdaten können Wartungsmaßnahmen gezielter und effizienter durchgeführt werden. Dies reduziert unnötige Wartungsmaßnahmen und verlängert die Lebensdauer der Geräte. |
| • | Kosteneinsparungen: Eine optimierte Instandhaltungsstrategie kann die Betriebskosten senken, da nur solche Maßnahmen umgesetzt werden, die bezüglich ihrer Wirksamkeit in den gegebenen Rahmenbedingen nützlich sind. Vielfach können Maßnahmen aus den Herstellerempfehlungen entfallen oder Intervalle verlängert werden. |
| • | Erhöhte Sicherheit: Die evidenzbasierte Instandhaltung trägt dazu bei, die Sicherheit der Patienten und des medizinischen Personals zu erhöhen, indem sie unter realen Nutzungsbedingungen auch Risiken identifiziert, die in den Überlegungen der Hersteller nicht berücksichtigt werden konnten. |
| • | Regulatorische Konformität: In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es nationale Vorschriften, die die Instandhaltung von Medizinprodukten regeln. In diesen Regulierungen wird bei der Instandhaltung auf die Beachtung der Herstellerinformationen verwiesen. Viele Passagen in diesen Texten verweisen allerdings darauf, dass Erfahrungen aus dem Betrieb in die Instandhaltungsstrategien einfließen dürfen und situativ sogar einfließen müssen, um die Sicherheit der Medizinprodukte in ihrem Anwendungsumfeld zu gewährleisten. Eine evidenzbasierte Strategie hilft dabei, diese Anforderungen zu erfüllen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu gewährleisten. |
Abbildung 1 stellt die Herleitung der evidenzbasierten Instandhaltung dar.
Abb. 1: Herleitung evidenzbasierter Instandhaltung, vereinfachte Darstellung
Die europäische Medizinprodukte-Verordnung 2017/745 (MDR) enthält keine Anforderungen an Gesundheitseinrichtungen bezüglich der Instandhaltung von Medizinprodukten. Dies regeln die nationalen Gesetze und Verordnungen, die die EU-Verordnung umsetzen, und die auf einem nationalen Gesetz wie dem deutschen Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) basierende deutsche Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) oder die schweizerische Medizinprodukteverordnung (MepV). Die deutsche MPBetreibV verlangte bisher von den Gesundheitseinrichtungen, bei Inspektionen, Wartungen und Überprüfungen, wie sicherheitstechnischen und messtechnischen Kontrollen (STK + MTK), die Fristen und Inhalte gemäß Herstellervorgaben durchzuführen.
Die Betreiber von Medizinprodukten werden bei der Durchführung von Wartungen und Sicherheitskontrollen von den Aufsichtsbehörden auf die exakte Einhaltung der Herstellervorgaben kontrolliert. Aus diesem Grund wurden Wartungspläne und STK-Checklisten der Hersteller normalerweise fristgerecht erfüllt und Punkt für Punkt abgearbeitet. Mittlerweile hat ein deutlich erkennbarer Paradigmenwechsel stattgefunden, indem die Verantwortung für die Termine und Inhalte der Instandhaltung immer mehr auf Gesundheitseinrichtungen übertragen werden. Dies bedeutet, dass Gesundheitseinrichtungen Fristen und Inhalte von Instandhaltungsmaßnahmen eigenverantwortlich in einer Strategie festlegen können und müssen.
So ist die aktuelle Situation in den Ländern Deutschland und der Schweiz:
| • | Deutschland: Medizinprodukte-Betreiberverordnung § 7. („Instandhaltung von Produkten”): „Die Angaben des Herstellers sind dabei zu berücksichtigen.” § 12 („Sicherheitstechnische Kontrollen”): „Ist aufgrund der konkreten Benutzungs- und Umgebungsbedingungen des Produktes zu einem früheren Zeitpunkt [als 2 Jahre, Anm. d. Redaktion] mit Mängeln zu rechnen, ist der Betreiber verpflichtet, rechtzeitig vor Ablauf der zwei Jahre sicherheitstechnische Kontrollen durchzuführen oder durchführen zu lassen.” |
| • | Schweiz: In der Schweiz wird in der Medizinprodukteverordnung verlangt, bei der Wahl der Instandhaltungsstrategie die Anweisungen des Herstellers zu beachten und das Risiko des Produkts und dessen Verwendung zu berücksichtigen (MepV Art. 71). Fachpersonen, die ein Medizinprodukt verwenden, müssen vor jeder erneuten Anwendung die Funktionsfähigkeit überprüfen. (MepV Art. 72). Auf Basis dieser Artikel hat das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic eine Wegleitung verfasst („Gute Praxis der Instandhaltung in der Medizintechnik”, GPI 2025) in der darauf verwiesen wird, dass eine evidenzbasierte Instandhaltungsstrategie angewendet werden kann. |
Diese Textauszüge sollen keine Rechtsgrundlagen erklären oder juristische Beweislagen aufzeigen. Es geht darum, die Passagen aufzuzeigen, die eine Abwägung von Instandhaltungsmaßnahmen zulassen und zum Teil auch fordern. Auch in den Normen EN 62353 und EN 14971 finden sich entsprechende Verweise (siehe Übersicht Normenverweis).
Die neue Richtlinie VDI 5707 Blatt 1 beschreibt das methodische Vorgehen zur evidenzbasierten Instandhaltung aktiver Medizinprodukte im klinischen Einsatz und liefert begründete Empfehlungen für diese Instandhaltungsstrategie. Diese Richtlinie unterstützt Organisationen dabei, ihre Instandhaltungsprozesse zu optimieren und die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten.
Weiterführende Links
| • | Gesetze im Internet: MPDG |
| • | Gesetze im Internet: MPBetreibV |
| • | BAG (Schweiz): Medizinprodukterecht |
| • | |
| • | Swissmedic: Instandhaltung |
2 Neuer risikobasierter Ansatz
Die evidenzbasierte Instandhaltung von Medizinprodukten ist ein wichtiger Bestandteil der Gewährleistung von Patientensicherheit und -wohlfahrt. Ein neuer risikobasierter Ansatz innerhalb dieser Instandhaltung ist dabei nicht nur empfehlenswert, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Dabei stehen wichtige Vorgaben im Sinne der Umsetzung eines Risikomanagements im Fokus (Beispiele):
| • | individuelle Risiken: Medizinprodukte sind äußerst vielfältig und werden in unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt. Die daraus resultierenden Risiken variieren stark. Ein einheitlicher Instandhaltungsplan für alle Geräte wäre daher nicht zielführend und könnte sowohl zu Überwartung als auch zu Unterwartung führen. |
| • | Kostenoptimierung: Durch einen risikobasierten Ansatz können Ressourcen gezielt auf die Komponenten und Systeme konzentriert werden, die das höchste Risiko für Ausfälle oder Komplikationen darstellen. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung von Ressourcen und reduziert unnötige Kosten. |
| • | Patientensicherheit: Durch die Fokussierung auf risikoreiche Bereiche wird die Wahrscheinlichkeit von Geräteausfällen und damit verbundenen Risiken für Patienten minimiert. Ein risikobasierter Ansatz trägt somit direkt zur Verbesserung der Patientensicherheit bei. |
| • | Compliance: Viele gesetzliche Bestimmungen und Normen, wie die EU-Medizinprodukteverordnung (MDR), fordern einen risikobasierten Ansatz für die Instandhaltung von Medizinprodukten. Die Nichtbeachtung dieser Vorgaben kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen. |
| • | Flexibilität: Ein risikobasierter Ansatz ermöglicht es, Instandhaltungspläne flexibel an sich ändernde Bedingungen anzupassen. So können beispielsweise neue Erkenntnisse aus der Nutzung oder neue gesetzliche Anforderungen schnell berücksichtigt werden. |
Bezug-Links:
| • | Medical Device Regulation (MDR): Die MDR (EU-Verordnung 2017/745) ist die zentrale Rechtsgrundlage für Medizinprodukte in der EU. Sie legt umfassende Anforderungen an den gesamten Lebenszyklus von Medizinprodukten fest, einschließlich der Instandhaltung. Ein risikobasierter Ansatz ist hier explizit verankert. |
| • | ISO 13485:2021-12: Diese internationale Norm spezifiziert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem für die Herstellung von Medizinprodukten. Sie enthält auch Anforderungen an das Risikomanagement und die Instandhaltung. |
| • | ISO 14971:2022-04: Diese Norm legt die Anforderungen an das Risikomanagement für Medizinprodukte fest. Sie ist ein unverzichtbares Instrument für die Durchführung einer Risikoanalyse und die Ableitung geeigneter Maßnahmen. |
| • | DIN EN 60601-1:2022-11 + Teile: Diese Normreihe legt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen an medizinische elektrische Geräte fest. |
| • | DIN EN 62353:2015-10 (VDE 0751-1:2015-19) Medizinische elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten |
2.1 Direkte und indirekte Kosten der Instandhaltung
Bei der Instandhaltung von Medizingeräten entstehen Kosten. Dabei stehen die direkten, laufenden Instandhaltungskosten der Medizingeräte und IT-Anlagen den zum Großteil kaufmännisch nicht sofort erfassbaren indirekten Kosten (Ausfallkosten, also die Kosten, die entstehen, wenn Medizingeräte oder Anlagen ausfallen) gegenüber.
Die Erfassung indirekter Instandhaltungskosten ist schwierig und aufgrund der komplexen Zusammenhänge in verketteten Prozessen auch wenig transparent, wenn es um eine Kennzahlenermittlung geht. Das ist insbesondere der Fall bei Medizingeräten, die nicht an ein Data Warehouse angeschlossen sind.
Indirekte Kosten
Unter indirekten Instandhaltungskosten versteht man alle Kosten, die nicht direkt mit der Reparatur oder Wartung des Geräts verbunden sind, aber dennoch erhebliche finanzielle Auswirkungen haben können (Beispiele):
Unter indirekten Instandhaltungskosten versteht man alle Kosten, die nicht direkt mit der Reparatur oder Wartung des Geräts verbunden sind, aber dennoch erhebliche finanzielle Auswirkungen haben können (Beispiele):
| 1. | Produktionsausfälle: Wenn ein medizinisches Gerät ausfällt, kann dies zu Unterbrechungen in der ganzheitlichen Patientenversorgung führen. Dies kann besonders kritisch sein, wenn lebenswichtige Geräte betroffen sind (Intensivstation, OP), was zu Verzögerungen bei Behandlungen und Operationen führen kann. |
| 2. | Einnahmeverluste: Während der Ausfallzeiten können keine medizinischen Dienstleistungen erbracht und adäquat abgerechnet werden, was zu erheblichen Einnahmeverlusten für die Gesundheitseinrichtung (Krankenhaus, Klinik, MVZ) führt. Dieser Punkt ist besonders wichtig in der Betrachtung im Kontext der Krankenhausneuordnung – Krankenhausreform [1] [2] [3] |
| 3. | Qualitätsverluste: Ein Ausfall kann die Qualität der Patientenversorgung beeinträchtigen, was sich negativ auf die Patientensicherheit und -zufriedenheit auswirken kann. |
| 4. | Zusätzliche Arbeitskosten: Das Personal muss möglicherweise zusätzliche Zeit aufwenden, um alternative Lösungen zur Wiederherstellung des Betriebs ausgefallener Medizinprodukte zu finden oder manuelle Prozesse (dezentrale Instandsetzung/Bedarfsinstandsetzung) durchzuführen, was zu höheren Personalkosten führen könnte. |
| 5. | Vertragsstrafen und rechtliche Konsequenzen: In einigen Fällen können Ausfälle zu Vertragsstrafen oder rechtlichen Konsequenzen führen, insbesondere wenn sie gegen gesetzliche Vorschriften oder vertragliche Verpflichtungen verstoßen (Organisationsverschulden Krankenhaus/Spital/Klinik). |
| 6. | Reputationsschäden: Wiederholte oder schwerwiegende Ausfälle können das Vertrauen der Patienten und der Öffentlichkeit in die Gesundheitseinrichtung beeinträchtigen, was langfristige Auswirkungen auf die Reputation und den Geschäftserfolg haben kann. |
Indirekte Instandhaltungskosten sind oft schwer zu quantifizieren, aber sie können erhebliche finanzielle Belastungen für Krankenhäuser/Spitäler und Kliniken darstellen und die Effizienz und Qualität der medizinischen Versorgung beeinträchtigen.
2.2 Neue Elemente der Instandhaltung
Ein risikobasierter Ansatz für die evidenzbasierte Instandhaltung von Medizinprodukten ist ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit und Verfügbarkeit der Medizingeräte in deren realen Nutzungsumgebung. Durch eine gezielte Fokussierung auf die kritischen Bereiche können Kosten reduziert, die Patientensicherheit erhöht und gesetzliche Anforderungen erfüllt werden. Dabei werden folgende Elemente in der Instandhaltung neu eingeführt (Beispiele):
| • | Risikoanalyse: Zunächst werden alle potenziellen Risiken identifiziert, die mit dem Medizinprodukt verbunden sind. Dazu gehören beispielsweise Ausfälle von Komponenten, Bedienfehler oder Umwelteinflüsse. |
| • | Risikobewertung: Die identifizierten Risiken werden hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit und ihrer möglichen Auswirkungen bewertet. |
| • | Risikopriorisierung: Auf Grundlage der Bewertung werden die Risiken priorisiert. Diejenigen Risiken, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit schwerwiegende Folgen haben, werden als Erstes adressiert. |
| • | Maßnahmenplanung: Für jedes Risiko werden geeignete Maßnahmen zur Risikominderung definiert. Auch an dieser Stelle sollte hinterfragt werden, ob die vom Hersteller genannten Instandhaltungsmaßnahmen geeignet sind, den identifizierten Risiken angemessen zu begegnen. Dies können beispielsweise zusätzliche Prüfungen, Schulungen des Personals oder eine häufigere Wartung sein. |
| • | Überwachung und Anpassung: Die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen wird regelmäßig überprüft. Bei Bedarf werden die Maßnahmen angepasst. |
Risikobasierte Instandhaltungsstrategien verfolgen einen datenbasierten, strategischen Ansatz (plattformbasiert) für Medizingeräteausfälle. Mithilfe risikobasierter Bewertungen von vernetzten Medizingeräten können Krankenhäuser/Spitäler und Kliniken die Ausfallwahrscheinlichkeit für jedes Gerät durch Kennzahlenermittlung eruieren. Im Ergebnis dieses Prozesses – evidenzbasierte Instandhaltung als Prozess – setzen die Mitarbeiter der Medizintechnik mehr Zeit und Ressourcen für die Überwachung und Wartung derjenigen Medizingeräte mit dem höchsten Ausfallrisiko ein. Wie andere Instandhaltungsstrategien zielen auch risikobasierte Instandhaltungstaktiken darauf ab, die Ausfallzeiten von Medizingeräten zu minimieren und die Wahrscheinlichkeit von Anlagenausfällen zu verringern, die den Krankenhaus-/Spital-Routinebetrieb beeinträchtigen können.
2.3 Data Warehouse zur Kennzahlenermittlung
Ein Data Warehouse kann definiert werden als der Prozess der Datenerfassung und -speicherung aus verschiedenen Quellen (z. B. vernetzten Medizingeräten) und deren Verwaltung, um wertvolle Geschäftseinblicke zu liefern (zum Beispiel zu Instandhaltungskosten). Es kann auch als elektronischer Speicher bezeichnet werden, in dem Gesundheitsunternehmen eine große Menge an Daten und Informationen speichern, um an krankenhaus-/spitalrelevante Kennzahlen zu gelangen. Es ist eine Komponente eines Business-Intelligence-Systems, das Techniken zur Datenanalyse (im Fallbeispiel Daten von Medizinprodukten) umfasst.