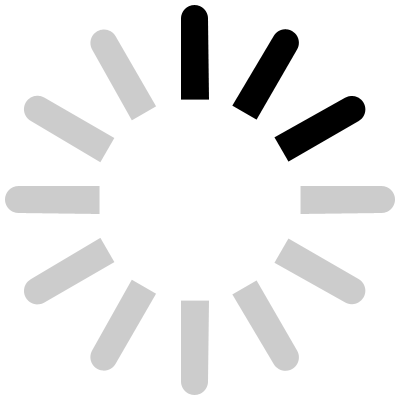05301 Digitale Gesundheitsanwendungen in der Medizin – Einführung
|
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), auch als „Gesundheits-Apps” bekannt, haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Gesundheitsversorgung verstehen und nutzen, grundlegend zu verändern.
MIT möchte an dieser Stelle eine neue Rubrik aufmachen um das Wissen über die Medizinprodukte (Software als Medizinprodukt) zu teilen. von: |
Gesundheits-Apps
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind Softwareanwendungen, die auf Smartphones, Tablets oder anderen tragbaren Geräten aus App-Shops installiert werden können und dazu dienen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer (Patienten) zu verbessern. Sie reichen von einfachen Fitness-Trackern und Ernährungstagebüchern bis hin zu komplexen Anwendungen zur Überwachung chronischer Krankheiten, zur Unterstützung der psychischen Gesundheit und zur Verbesserung der medizinischen Versorgung. Im Prozess einer ganzheitlichen Patientenbetreuung gibt es ein neues Element: das Nutzererlebnis.
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind Softwareanwendungen, die auf Smartphones, Tablets oder anderen tragbaren Geräten aus App-Shops installiert werden können und dazu dienen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer (Patienten) zu verbessern. Sie reichen von einfachen Fitness-Trackern und Ernährungstagebüchern bis hin zu komplexen Anwendungen zur Überwachung chronischer Krankheiten, zur Unterstützung der psychischen Gesundheit und zur Verbesserung der medizinischen Versorgung. Im Prozess einer ganzheitlichen Patientenbetreuung gibt es ein neues Element: das Nutzererlebnis.
Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV) zieht im aktuellen, zweiten DiGA-Report Bilanz und kommt zu dem Schluss, dass digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) sowohl von Leistungserbringern als auch von Patienten als wirksames Instrument zur Beschleunigung des Genesungsprozesses und zur gleichzeitigen Entlastung des Gesundheitssystems betrachtet werden.
Nutzerstruktur
Die Nutzerstruktur digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGAs) räumt mit einigen gängigen Vorurteilen auf. Entgegen der Annahme, digitale Produkte seien primär etwas für jüngere Menschen, zeigt sich, dass DiGAs von allen Altersgruppen genutzt werden. Besonders intensiv sind die 50- bis 64-Jährigen, die mit 38 Prozent sogar den größten Anteil der Nutzer ausmachen. Bezüglich der Geschlechterverteilung fällt auf, dass etwa drei Viertel der DiGA-Anwender Frauen sind. Dies könnte verschiedene Ursachen haben, darunter DiGAs, die sich speziell an Frauen richten sowie Indikationen wie Depressionen, die häufiger bei Frauen diagnostiziert werden
Die Nutzerstruktur digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGAs) räumt mit einigen gängigen Vorurteilen auf. Entgegen der Annahme, digitale Produkte seien primär etwas für jüngere Menschen, zeigt sich, dass DiGAs von allen Altersgruppen genutzt werden. Besonders intensiv sind die 50- bis 64-Jährigen, die mit 38 Prozent sogar den größten Anteil der Nutzer ausmachen. Bezüglich der Geschlechterverteilung fällt auf, dass etwa drei Viertel der DiGA-Anwender Frauen sind. Dies könnte verschiedene Ursachen haben, darunter DiGAs, die sich speziell an Frauen richten sowie Indikationen wie Depressionen, die häufiger bei Frauen diagnostiziert werden
Vorteile
In der Medizin bieten DiGA eine Vielzahl von Vorteilen. Sie können den Zugang zu Gesundheitsdiensten verbessern, insbesondere in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten (medizinische Flächenversorgung). Sie können Patienten dabei helfen, ihre Gesundheit besser zu verstehen und zu managen, indem sie personalisierte Informationen und Feedback liefern. Sie können auch dazu beitragen, die Effizienz des Gesundheitssystems zu steigern, indem sie administrative Aufgaben automatisieren und die Kommunikation zwischen Patienten und Gesundheitsdienstleistern erleichtern (z. B. Videosprechstunde oder personalisierter medizinischer Videobetreuer).
In der Medizin bieten DiGA eine Vielzahl von Vorteilen. Sie können den Zugang zu Gesundheitsdiensten verbessern, insbesondere in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten (medizinische Flächenversorgung). Sie können Patienten dabei helfen, ihre Gesundheit besser zu verstehen und zu managen, indem sie personalisierte Informationen und Feedback liefern. Sie können auch dazu beitragen, die Effizienz des Gesundheitssystems zu steigern, indem sie administrative Aufgaben automatisieren und die Kommunikation zwischen Patienten und Gesundheitsdienstleistern erleichtern (z. B. Videosprechstunde oder personalisierter medizinischer Videobetreuer).
Herausforderungen
Trotz dieser Vorteile stehen die Technologie noch am Anfang der digitalen Gesundheitsrevolution. Die Integration von DiGA in die reguläre Gesundheitsversorgung stellt eine Reihe von Herausforderungen dar, darunter Fragen der Datensicherheit, der Benutzerfreundlichkeit und der Effektivität. Dennoch ist das Potenzial von DiGA enorm, und ihre weitere Entwicklung und Verbreitung könnte die Gesundheitsversorgung in den kommenden Jahren erheblich verändern.
Trotz dieser Vorteile stehen die Technologie noch am Anfang der digitalen Gesundheitsrevolution. Die Integration von DiGA in die reguläre Gesundheitsversorgung stellt eine Reihe von Herausforderungen dar, darunter Fragen der Datensicherheit, der Benutzerfreundlichkeit und der Effektivität. Dennoch ist das Potenzial von DiGA enorm, und ihre weitere Entwicklung und Verbreitung könnte die Gesundheitsversorgung in den kommenden Jahren erheblich verändern.
In diesem Kontext ist es wichtig, dass wir alle ein tieferes Verständnis für die Rolle von DiGA in der Medizin entwickeln. Dies wird uns dabei helfen, die Vorteile dieser Technologien zu maximieren und gleichzeitig potenzielle Risiken zu minimieren. Für die Medizin und die Gesundheitsversorgung werden DiGA in Zukunft zweifellos eine zentrale Rolle spielen.
Regulatorien
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) werden in Deutschland durch eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen reguliert (Beispiele):
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) werden in Deutschland durch eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen reguliert (Beispiele):
| • | Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG): Mit dem DVG wurde ein neuer Leistungsanspruch auf Versorgung mit DiGA eingeführt. Es ermöglicht, dass Gesundheits-Apps von den Krankenkassen bezahlt und von Ärzten und Psychotherapeuten verschrieben werden können |
| • | Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV): Die DiGAV und der Leitfaden des Bundesministeriums für Gesundheit und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte definieren die Anforderungen an DiGA, insbesondere hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Datenschutz und Datensicherheit |
| • | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM): DiGA müssen eine Prüfung auf Anforderungen wie Sicherheit, Funktionstauglichkeit, Datenschutz und Datensicherheit beim BfArM durchlaufen haben. Sie müssen auch einen positiven Versorgungseffekt nachweisen. Nur die vom BfArM geprüften und im DiGA-Verzeichnis gelisteten Anwendungen werden von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet |
| • | Patientendaten-Schutz-Gesetz: Dieses Gesetz macht digitale Angebote wie die elektronische Patientenakte (ePA) oder das E-Rezept nutzbar |
Damit eine digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen werden kann, muss der Hersteller einen Antrag zur Aufnahme in das Verzeichnis stellen. Das BfArM prüft diesen Antrag. Nach Abschluss des Verfahrens erhält der Hersteller einen Bescheid, ob seine DiGA die Kriterien zur Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis erfüllt.